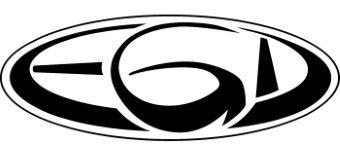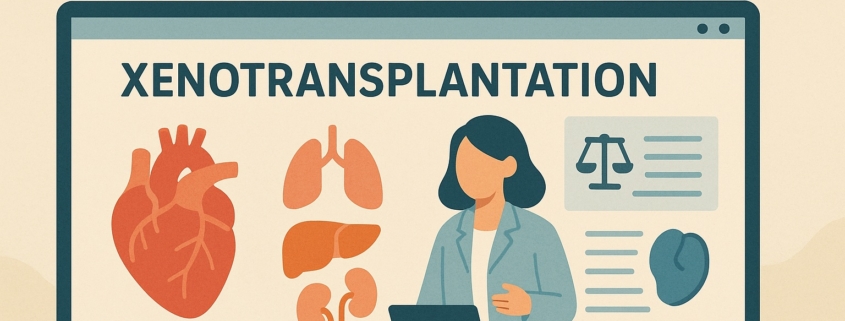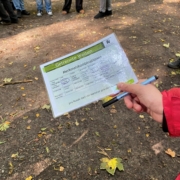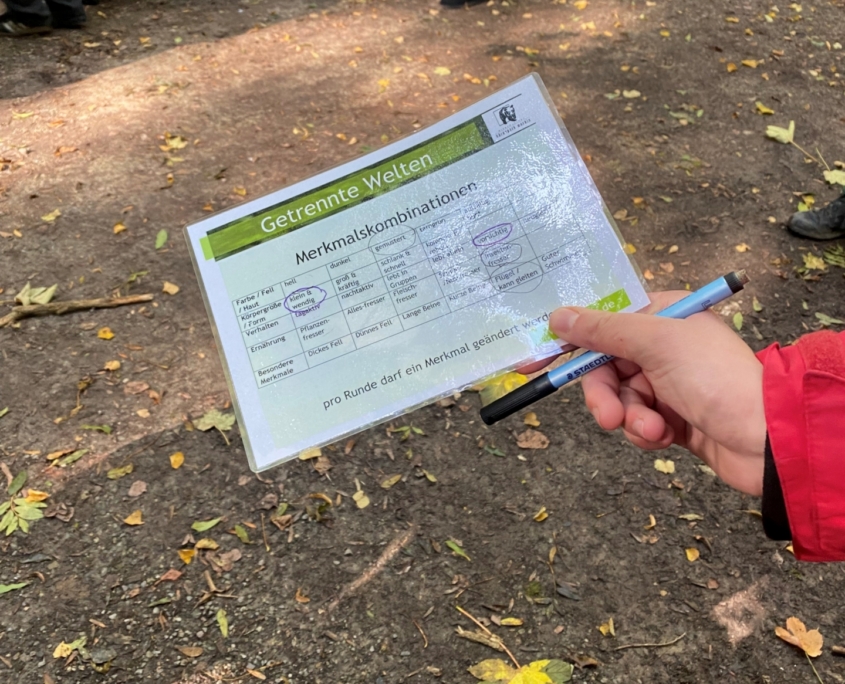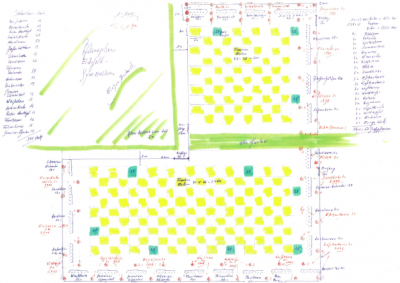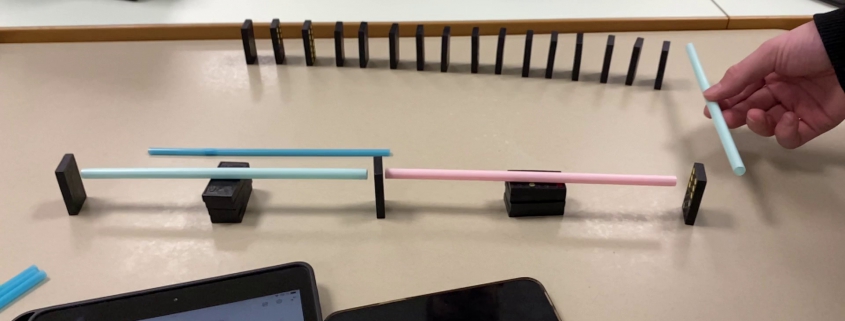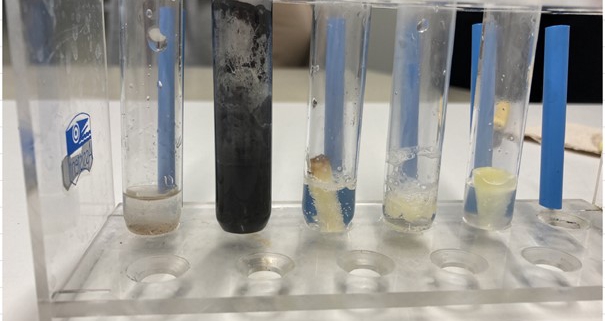Besuch des DPZ Göttingen: Faszinierende Einblicke in die Gehirnforschung
Am 7.11. hatten die Bio-Kurse des Jahrgangs 12 die besondere Gelegenheit, Frau Prof. Dr. Katharina Boretius vom Deutschen Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen zu begrüßen. In einem spannenden Vortrag nahm sie uns mit in die Welt der modernen Gehirnforschung und zeigte, wie vielfältig und faszinierend die Arbeit an einem Forschungsinstitut sein kann.
Frau Prof. Boretius berichtete zunächst von ihrem persönlichen Werdegang, der sie über verschiedene Stationen in der Wissenschaft schließlich ans DPZ führte. Dabei wurde deutlich, wie vielseitig und interdisziplinär die Forschung rund um das Gehirn ist – von der Biologie über Physik bis hin zur Medizin.
Im Mittelpunkt des Vortrags stand das Dopamin, ein zentraler Botenstoff im Gehirn, der unser Lernen, unsere Motivation und unser Belohnungssystem beeinflusst. Mit anschaulichen Beispielen und beeindruckenden Bildern erklärte Frau Prof. Boretius, wie Dopamin wirkt und welche Rolle es bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen und bei der Verwendung von Social Media spielt.
Besonders interessant und lebendig wurde es am Ende der Veranstaltung: In einer offenen und konstruktiven Diskussion über Tierversuche und aktuelle Forschungsfragen beantwortete Frau Prof. Boretius geduldig und ehrlich alle Fragen der Schülerinnen und Schüler. So entstand ein spannender Dialog über ethische Verantwortung und die Bedeutung von Grundlagenforschung.
Ein großes Dankeschön gilt Frau Prof. Boretius für ihren Besuch und den inspirierenden Einblick in die Welt der Gehirnforschung – eine Veranstaltung, die sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.